|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Similapunktur – Homöopathie trifft Akupunktur
Andreas Maier Es braucht gute Gründe, will man zwei der bekanntesten Heilmethoden miteinander verbinden. Besonders dann, wenn beide auf völlig unterschiedlichen Ansätzen beruhen. Zwischen der Homöopathie und der Akupunktur gibt es allerdings einige interessante Schnittstellen, und obwohl sich Samuel Hahnemann, der Vater der Homöopathie, gegen die chinesische Nadeltherapie ausgesprochen hat, erscheint eine Synthese durchaus möglich – oder vielmehr sogar sinnvoll. Und sie muss von Hahnemanns Vorstellungen gar nicht weit entfernt sein. Eine revolutionäre EntdeckungAls der Herforder Arzt August Weihe (1840 - 1896) gegen Ende des 19. Jahrhunderts erkannte, dass innere Krankheiten mit schmerzhaften Punkten an der Körperoberfläche einhergehen, hätten die Mediziner seiner Zeit hellhörig werden können. Aber zumindest in der westlichen Welt maß man diesem Phänomen keine Bedeutung bei. Da Weihe ein ausgewiesener Homöopath war, hätten seine Entdeckungen auch für die Lehren Hahnemanns eine kleine Revolution bedeuten können. Allerdings bekam die Homöopathie durch den wachsenden Einfluss amerikanischer Praktiker eine ganz andere Richtung. Dr. Weihe hatte jedoch nicht nur einen Zusammenhang zwischen inneren Störungen und Schmerzpunkten nachgewiesen, sondern auch zwischen diesen Punkten und homöopathischen Arzneien. Das Besondere daran: die Punkte traten nicht willkürlich auf, vielmehr konnten anatomisch genau definierte Bereiche bestimmten Beschwerdebildern und entsprechenden Homöopathika zugewiesen werden. Für den eifrigen Arzt und Forscher eröffneten sich damit neue Möglichkeiten bei der Arzneidiagnose. Schließlich erlaubten die Weiheschen Druckpunkte eine exakte Differenzierung verschiedener Homöopathika, die bei einem vorliegenden Krankheitsfall miteinander konkurrierten. Weihe entwickelte schließlich ein System, das in mancher Hinsicht jedoch eher dem Krankheitsverständnis des Naturarztes Johann Gottfried Rademacher (1772 – 1850) entsprach und dabei erheblich von Hahnemanns Grundsätzen abwich. Und so sind die Weiheschen Druckpunkte bis heute eine Randerscheinung in der Homöopathie. Der französische Arzt und Akupunkteur Roger der la Fuye (1890 – 1961) wiederum erkannte in Weihes Entdeckung eine Möglichkeit, die Homöopathie mit der Akupunktur zu verbinden. Zunächst verglich er die Weihe-Punkte mit den damals bekannten Akupunkturpunkten und stellte bei den meisten Punkten eine verblüffende Übereinstimmung sowohl hinsichtlich der Lokalisation als auch der Indikationen fest. Denn ähnlich wie in der Homöopathie werden auch Akupunkturpunkte nicht anhand von medizinischen Krankheitsdiagnosen behandelt, vielmehr wird ihnen eine Gruppe von Symptomen zugeordnet, bei denen sie hilfreich sein können. Dabei gibt es Punkte mit großem Anwendungsspektrum, aber auch Spezialpunkte mit wenigen, dafür scharf umrissenen Indikationen – entsprechend den Polychresten oder kleinen Mitteln in der Homöopathie. De la Fuye sah auch den therapeutischen Nutzen der Weiheschen Druckpunkte und fing an, homöopathische Arzneien an Akupunkturpunkte zu injizieren. Die Therapie, die er als Homöosiniatrie bezeichnete, basiert weitgehend auf der Philosophie der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM). De la Fuye applizierte beispielsweise Lebermittel an entsprechende Punkte der Leber-Leitbahn, um die gestörte „Leber-Energie“ auszugleichen. Für klassische Homöopathen war diese Vorgehensweise aus mehreren Gründen keine Option, und so nimmt die Homöosiniatrie im großen Spektrum der Naturheilkunde bis heute nur eine unbedeutende Nebenrolle ein. Ein neuer AnsatzMittlerweile gibt es neben der Homöosiniatrie noch weitere Methoden, bei denen homöopathische oder pflanzliche Mittel an Akupunkturpunkte injiziert werden, wie z. B. Biopunktur, Mesotherapie oder Homöopunktur. Bei den dabei verwendeten Arzneien handelt es sich meist um Komplexpräparate, wobei die enthaltenen Wirkstoffe oft sehr niedrig potenziert sind. Einzelmittelverordnungen in mittleren oder höheren Potenzen sind bei diesen Behandlungskonzepten kaum möglich. Die Grundprinzipien der Homöopathie, also eine Mittelwahl entsprechend dem Ähnlichkeitsgesetz sowie die Anwendung von Einzelmitteln in möglichst geringer Gabengröße lassen sich folglich bei den genannten Therapieformen nicht umsetzen. Bei der neu entwickelten Similapunktur gelten diese Prinzipien jedoch uneingeschränkt, gleichzeitig können die Effekte der Akupunktur, Reflexzonen- oder Triggerpunkttherapie in das Behandlungskonzept integriert werden. Anders als bei den genannten Methoden werden bei der Similapunktur die Arzneien nicht injiziert, sondern äußerlich aufgetragen. Samuel Hahnemann selbst lehnte äußerliche Anwendungen der Mittel zwar lange Zeit entschieden ab, änderte aber schließlich seine Meinung. Insbesondere bei chronischen Krankheiten erkannte er das Potenzial von Einreibungen, um den Heilungsprozess zu beschleunigen. So schreibt er in seinem Werk „Die chronischen Krankheiten“ (Einführungsband): „Wird […] dieselbe heilsam befundene Arznei in Wasser-Auflösung zugleich äusserlich (selbst nur in kleiner Menge) eingerieben an einer oder mehren Stellen des Körpers, welche am meisten frei von Krankheits-Beschwerden ist (z.B. an einem Arme, oder Ober- oder Unterschenkel, der weder auf der Haut, noch an Schmerzen, noch auch an Krämpfen leidet) so wird die heilsame Wirkung um Vieles vermehrt […]. So erhält der Arzt noch bei Weitem mehr Vortheil von der homöopathisch passenden Arznei für den langwierig Kranken und kann ihn weit schneller heilen als durch blosses Einnehmen durch den Mund.“ [Hervorhebung durch den Autor] Allerdings erregte Hahnemanns Miasmen-Theorie, die er in diesem Grundlagenwerk erstmals erläuterte, ein viel größeres Aufsehen als jener kleine Hinweis auf die Einreibungen. Viele hielten den mittlerweile über 70 Jahre alten Querkopf mit seinen Ausführungen über Psora, Sykose und Syphilis jedoch für senil und distanzierten sich von dieser streitbaren Theorie. Bis heute werden die Miasmen kontrovers diskutiert, die Möglichkeiten äußerlicher Anwendungen hingegen werden kaum in Erwägung gezogen. Dabei hat Hahnemann in der letzten Ausgabe seines „Organons“, dem bis heute wichtigsten Lehrbuch der Homöopathie, noch einmal auf diese Applikationsform hingewiesen. Ausgehend von seinen Erläuterungen in den „Chronischen Krankheiten“ und dem „Organon“ (6. Auflage) lässt sich festhalten:
Umfragen zufolge suchen insbesondere Patienten mit chronischen Krankheiten wie Allergien, Asthma, Migräne, Kopfschmerzen oder sonstigen Schmerzzuständen, Reizdarmsyndrom usw. Hilfe durch die Homöopathie. Umso erstaunlicher, dass die von Hahnemann beschriebene Möglichkeit, den Heilungsprozess bei derartigen Fällen zu beschleunigen, von seinen Anhängern nicht umgesetzt wird. In der Praxis hat sich gezeigt, dass Einreibungen der Mittel selbst bei akuten Krankheiten schnell und sicher wirken. Dabei können sie die orale Einahme in vielen Fällen nicht nur ergänzen, sondern sogar ganz ersetzen. Dies entspricht wiederum Hahnemanns Forderung nach einer minimalen Arzneigabe in seltenen Wiederholungen. Die Haut als Informationszentrum„Die Möglichkeit der Beeinflussung des Organismus – bis hin zur Sucht-Therapie – von kleinsten Punkten und Arealen an der Körperoberfläche aus ist eine Herausforderung an den westlichen Mediziner. Erst wenn man die Vielzahl der Punkte als Teil eines den ganzen Organismus überspannenden Projektions- und Korrespondenzsystems erfasst, wird der kommunikativ-regulative Charakter dieser Systeme offenbar.“ (J. Gledisch, Reflexzonen und Somatotopien) Die Haut mit ihren verschiedenen Schichten ist unser größtes Sinnesorgan und gleichzeitig Kontaktstelle zur Außenwelt. Sie schützt uns vor krankmachenden Einflüssen, hält die Gewebe zusammen und spiegelt Vorgänge im Körperinneren wider. Gleichzeitig bietet sie die Möglichkeit, innere Organe zu beeinflussen und damit krankhafte Störungen zu beseitigen – eine Besonderheit, die sich insbesondere naturheilkundliche Therapien zunutze machen. In der Akupunktur werden seit Jahrtausenden spezielle Punkte an der Haut und in darunterliegenden Geweben stimuliert, um Krankheiten aller Art zu lindern oder zu heilen. Die moderne Triggerpunkt-Therapie kennt zahlreiche Punkte in der Muskulatur, über die entfernt liegende Beschwerden behandelt werden können. Und an Reflexzonen bzw. Somatotopien bilden sich sämtliche Organe des Körpers ab, die über spezifische Reize reguliert werden können. Einige Zeit nach Dr. Weihe entdeckten Henry Head (1861 – 1940) und James MacKenzie (1853 – 1925) unabhängig voneinander eine Verbindung von Schmerzzonen zu organischen Störungen. Durch die Entwicklung neuer apparativer Diagnoseverfahren rückte diese Erkenntnis jedoch schnell in den Hintergrund, sodass die Segmentdiagnostik heute fast ausschließlich in Naturheilpraxen angewendet wird. Dabei liefern schmerzhafte Punkte oder Areale an der Oberfläche nicht nur diagnostische Hinweise, vielmehr bieten sie auch eine Ansatzstelle für die Therapie. Homöopathie punktgenauIn der Homöopathie scheinen derartige Zuammenhänge zunächst unerheblich, der Fokus der Behandlung richtet sich fast ausschließlich auf die Suche nach dem passenden Heilmittel, dem Simile. Das Simile ist auch Ausgangspunkt der Similapunktur, wenngleich andere Wirkmechanismen die Mittelwirkung ergänzen sollen. Als Reiz- und Regulationstherapie hängt der Therapieeffekt in der Homöopathie vorwiegend von der Reizart (Homöopathikum), der Reizstärke (Potenzierung und Zubereitung der Arznei) sowie der Reizwiederholung (Dosierung) ab. Bei der Similapunktur spielt darüber hinaus auch der Reizort eine wichtige Rolle. Deshalb kommt der körperlichen Untersuchung eine größere Bedeutung zu als in klassischen Homöopathiepraxen. Folgt man Hahnemanns Anweisungen, dann soll sich der Patient das Mittel, das innerlich eingenommen gut wirkt, äußerlich an der Haut einreiben, und zwar am besten an einem Arm, Ober- oder Unterschenkel oder am Rücken. Die Stelle soll dabei frei von Hautausschlägen, Krämpfen oder Schmerzen sein. Für die Praxis bleiben dennoch viele Fragen ungeklärt. Wie viel soll von der Flüssigkeit eingerieben werden? Wie stark soll die Einreibung erfolgen? Soll auf der rechten oder linken Seite, oder aber abwechselnd eingerieben werden? Zudem dürfte der Rücken für viele Patienten für die Eigenbehandlung schwer zugänglich sein. Deshalb ist die vielleicht wichtigste Frage: wer soll die Einreibung vornehmen? Bei der Similapunktur übernimmt konsequenterweise der Therapeut die Behandlung. Er wählt das Mittel, die Potenzierung, die Zubereitung und die Lokalisation. Er setzt den nötigen Heilimpuls, den der Patient noch im Behandlungsraum spüren kann. Technik der Similapunktur
„Blos das die äussere Fläche des Körpers umkleidende, dichtere Oberhäutchen legt der Einwirkung der Arzeneien auf die darunter liegende empfindliche Faser einiges, aber kein unüberwindliches Hinderniss in den Weg. Sie wirken gleichwohl durch dasselbe hindurch, nur mit schwächerer Kraft. […] Das Einreiben befördert grösstentheils nur dadurch die Einwirkung der Arzeneien, in wiefern das Reiben an sich die Haut empfindlicher und so die nun lebendiger und empfindungsfähiger gewordene Faser empfänglicher für die spezifische, durch sie auf den ganzen Organismus umstrahlende Arzeneikraft macht.“ Um die Haut entsprechend Hahnemanns Forderung empfindungsfähiger und für die Arznei empfänglicher zu machen, können verschiedene Techniken angewendet werden. Zur punktgenauen Anwendung hat sich in der Similapunktur auch die Siebensternenadel bewährt. Beim wiederholten sanften Beklopfen mit dem Nadelhämmerchen – einem Instrument, das seit Jahrhunderten in der Chinesischen Medizin angewendet wird – werden die oberen Hautschichten perforiert, sodass das anschließend aufgetragene Heilmittel gut aufgenommen werden kann. Die Stärke der Stimulation des tieferliegenden Akupunktur- oder Triggerpunkts bzw. der Reflexzone hängt von der Kraft der Klopfimpulse ab, wobei auch hier die Arndt-Schulz-Regel gilt und die individuelle Empfindlichkeit des Patienten zu berücksichtigen ist. Es hat sich jedoch gezeigt, dass selbst nadelsensitive Patienten sehr gut mit der Siebensternenadel behandelt werden können, zumal sie ursprünglich zur Anwendung bei Kindern entwickelt wurde. Grundsätzlich werden möglichst wenig Punkte stimuliert, wobei meist ein bis zwei gut gewählte Punkte für die Behandlung genügen. Im Vergleich dazu werden bei der herkömmlichen Akupunktur oft zehn, zwölf Nadeln und mehr gestochen. Zudem müssen Akupunktursitzungen zumindest zu Beginn der Behandlung in kurzen Abständen wiederholt werden, je nach Krankheitsfall sind zwei bis drei Sitzungen pro Woche nötig. Bei der Similapunktur ist dies aufgrund der zusätzlichen Wirkung des Homöopathikums nicht angezeigt bzw. sogar kontraindiziert. Vorteile der Methode Es braucht wie gesagt gute Gründe, wenn man verschiedene Verfahren miteinander kombinieren möchte. Zusätzlich zu der bereits erwähnten beschleunigten Wirkung gibt es noch weitere Argumente, die für die Similapunktur sprechen. Einerseits kommt der Behandler durch die eingehende körperliche Untersuchung wieder vermehrt in direkten Kontakt mit dem Patienten – ein Aspekt, der bei manchen Strömungen innerhalb der Homöopathie leider viel zu kurz kommt. Der Therapeut wird bei der Similapunktur vom Verordner zum Behandler, im wahrsten Sinn. Zudem bekommt er wieder die Kontrolle über Arzneigabe, Dosierung und Wiederholung des Mittels. Dabei kann der Effekt einer einmaligen Anwendung über Wochen oder Monate anhalten. Die von Hahnemann geforderte gleichzeitige orale Einnahme der Mittel ist nur in Ausnahmefällen nötig, vielmehr erfüllt die Similapunktur das homöopathische Grundprinzip der kleinsten Arzneigabe. Wie bereits erwähnt wird die Anwendung für den Patienten bereits im Behandlungsraum spürbar. Meist berichten die Behandelten über ein angenehmes Kribbeln, Brennen, Jucken oder ein Wärmegefühl. Eine leichte Hautrötung nach dem Beklopfen mit der Siebensternenadel weist auf eine verbesserte lokale Durchblutung mit erhöhtem Stoffwechsel hin. Der Heilreiz wird in vielen Fällen allerdings nicht nur lokal verspürt, vielmehr kommt es zu einer allgemeinen Reaktion bzw. der Patient spürt den Reiz bis in tieferliegende Organe. Fazit Obwohl es bereits einige Kombinationen von Akupunktur und Homöopathie gibt, geht die Similapunktur einen anderen Weg und orientiert sich dabei weitgehend an den Prinzipien Samuel Hahnemanns. Die punktgenaue Anwendung homöopathischer Arzneien bei gleichzeitiger Stimulierung wirkkräftiger Bereiche an der Haut führt zu einem raschen Wirkungseintritt, der von den Patienten oft unmittelbar wahrgenommen werden kann. Für die korrekte Anwendung ist neben dem homöopathischen Arzneiwissen auch eine Kenntnis der Lage und Funktion von Akupunktur- und Triggerpunkten bzw. von Reflexzonen nötig. Selbst Energiezentren wie Chakras oder Dantians können mit der Methode stimuliert werden. Die Similapunktur vereint somit traditionelle Heilverfahren mit modernen Therapien und eröffnet damit neue Wege zu einer ganzheitlichen Betrachtung. Wichtiger Hinweis für den
Einsatz der Rezepte Inhaltliche Verantwortung und zur
Kontaktaufnahme: Andreas Maier ist Heilpraktiker und führt seit rund 20 Jahren eine Naturheilpraxis mit Schwerpunkt Homöopathie. Seit seinem Studiengang an der University of Central Lancashire (UCLAN) mit Abschluss MSc Homeopathy beschäftigt er sich eingehend mit den Möglichkeiten äußerlicher Anwendungen homöopathischer Arzneien. Aus diesem Wissen geht die Similapunktur hervor, die er in der Praxis anwendet und immer weiterentwickelt. Kontakt
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









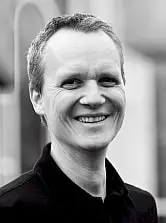
 Zunächst gibt es zahlreiche Möglichkeiten, therapeutisch
wirksame Bereiche am Körper wie Reflexzonen, Akupunkturpunkte usw. zu stimulieren. Durch Drücken, Reiben,
Beklopfen, Massieren, Nadeln, Wärme- oder Kältereize bis hin zu fein dosierten Laserstrahlen können
punktgenaue oder großflächige Reize gesetzt werden. Bei der
Zunächst gibt es zahlreiche Möglichkeiten, therapeutisch
wirksame Bereiche am Körper wie Reflexzonen, Akupunkturpunkte usw. zu stimulieren. Durch Drücken, Reiben,
Beklopfen, Massieren, Nadeln, Wärme- oder Kältereize bis hin zu fein dosierten Laserstrahlen können
punktgenaue oder großflächige Reize gesetzt werden. Bei der te Punkte anzuregen und gleichzeitig die
Hautoberfläche auf die Aufnahme des Homöopathikums vorzubereiten. Hahnemann empfahl die Einreibung aus gutem
Grund, wie er bereits in einem frühen Werk, der „Heilkunde der Erfahrung“ (erschienen 1805)
erläutert:
te Punkte anzuregen und gleichzeitig die
Hautoberfläche auf die Aufnahme des Homöopathikums vorzubereiten. Hahnemann empfahl die Einreibung aus gutem
Grund, wie er bereits in einem frühen Werk, der „Heilkunde der Erfahrung“ (erschienen 1805)
erläutert: